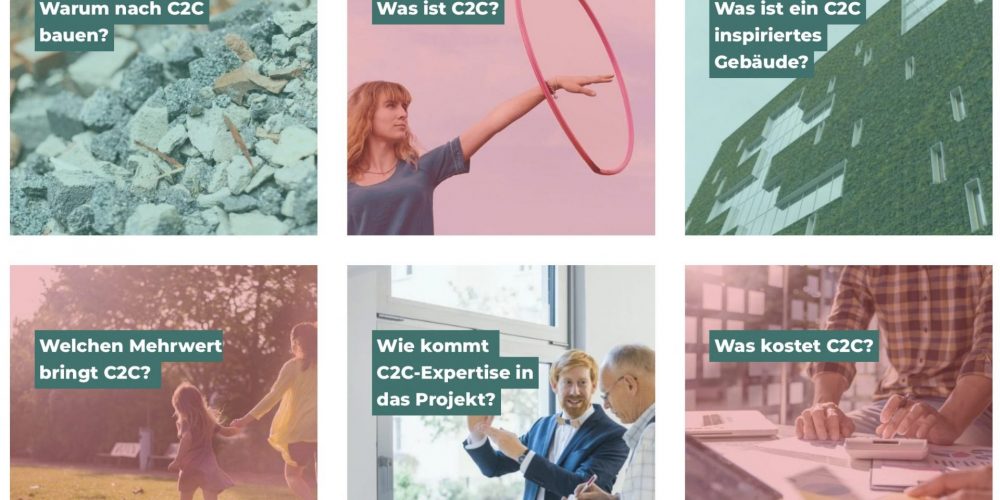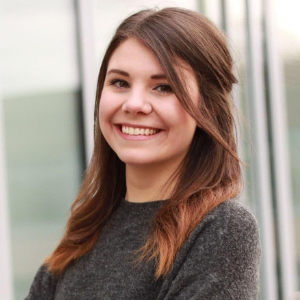Rund ein Jahr lang haben wir gemeinsam mit unseren ehrenamtlich Aktiven aus dem Bündnis Bau & Architektur und der NORDAKADEMIE an einem Leitfaden für die Umsetzung von C2C-inspirierten Gebäuden in Städten und Gemeinden gearbeitet. Am 2. März konnten wir die Handreichung „C2C im Bau: Orientierung für Kommunen“ endlich öffentlich vorstellen. Und, was sollen wir sagen: Die Arbeit hat sich gelohnt!
Pünktlich um 16:30 Uhr startete Nora Sophie Griefahn mit der offiziellen Begrüßung der Anwesenden in den Nachmittag. Ihr gegenüber: Die vielen bunten Kacheln der digital zugeschalteten Personen. Mehr als 140 Teilnehmende hatten sich an diesem Mittwoch auf Zoom oder im YouTube-Livestream versammelt, um der Vorstellung der Handreichung „C2C im Bau: Orientierung für Kommunen“ live beizuwohnen.
Bereits zuvor waren viele der Anwesenden in verschiedenen digitalen Themenräumen zusammengekommen, um sich kennenzulernen, Cradle to Cradle im Bau zu diskutieren und erste Kontakte zu knüpfen. Eine Erkenntnis dieser Networking-Sessions: Sowohl die Hintergründe der Teilnehmenden als auch ihre Beweggründe, dabei zu sein, hätten unterschiedlicher nicht sein können. Ob aus privatem oder beruflichem Interesse, ob mit der Intention C2C auf kommunaler Ebene zu fördern oder um den Bürgermeister einer deutschen Großstadt besser beraten zu können – alle einte der Wunsch, mehr über C2C im Bau zu erfahren.
Diesen Wunsch konnte Lena Junker erfüllen. Als Referentin für Kommunale Entwicklung bei C2C NGO und Projektleiterin sowie Co-Autorin der Handreichung stellte sie das in Form einer Webseite veröffentlichte Projekt detailliert vor. Nach anfänglichen Erläuterungen über die Struktur der Handreichung machte sie schnell deutlich, worin sich zirkuläre und herkömmliche Bauprojekte unterscheiden. „Die Projektphasen Gebäudebetrieb und Rückbau fehlen in konventionellen Bauvorhaben. Diese sind jedoch wichtig, um Materialkreisläufe zu schließen“, so Junker. Während bei konventionellen Bauvorhaben das Projekt häufig mit der Inbetriebnahme eines Gebäudes endet, denkt C2C weiter. Schon während seiner Nutzungszeit schafft ein C2C-inspiriertes Gebäude einen positiven Nutzen, indem die Luft gereinigt, CO₂ gebunden oder mehr Energie produziert als verbraucht wird. Zudem erhalten die Baustoffe und -materialien auch über die Nutzung hinaus ihren Wert und können durch eine modulare Bauweise dekonstruiert und in die Materialkreisläufe zurückgeführt werden.

Kommunen als Vorbild und finanzielle Vorteile
Neben technischen Details beantwortet die Handreichung auch organisatorische und logistische Fragen. So wird empfohlen, bei Bauvorhaben eine für C2C verantwortliche Person in das Projektteam aufzunehmen. Sie unterstützt die Beteiligten bei der Projektumsetzung, achtet auf fachgerechte Ausführung vor Ort und kümmert sich um Planung und Ausschreibung. Auch Kommunen können C2C-Verantwortliche einstellen und durch die Umsetzung von zirkulären Bauprojekten eine Vorbildfunktion einnehmen. Denn – und das ist eine wichtige Erkenntnis der Präsentation – Kommunen können durch ihr immenses Beschaffungsvolumen von rund 500 Mrd. Euro jährlich zum starken Beschleuniger für die Entwicklung einer Bauwirtschaft nach Cradle to Cradle werden.
Auch in finanzieller Hinsicht lohnt sich die Umstellung auf C2C für Kommunen. „Erfahrungswerte aus der Praxis des Bauplanungs- und Beratungsunternehmens EPEA zeigen eine Steigerung der Bau- und Planungskosten von 3% bei einer Wertsteigerung des Gebäudes als Rohstofflager von bis zu 10%“, so Junker und ergänzt: „Wenn wir die echten Kosten eines Gebäudes über die gesamte Nutzungsdauer betrachten, dann ist bauen nach C2C günstiger.“ Ein Beweis für diese Aussage steht im holländischen Venlo. Das dortige Gebäude der Stadtverwaltung ist in vielen Bereichen nach C2C gebaut und gilt als Vorzeigeobjekt. Laut einer Studie zum „Stadthaus Venlo” können die Mehrkosten von rund 3,4 Millionen Euro durch einen Restwert des Gebäudes von 16,9 Millionen Euro nach der festgeschriebenen Nutzungsdauer von 40 Jahren mehr als nur kompensiert werden.

Handreichung schafft Bewertungsgrundlage
Um über Baumaßnahmen oder die Auswahl von Produkten und Materialien zu entscheiden, definiert die Handreichung drei Kriterienkategorien, die als Entscheidungsgrundlage fungieren sollen. Das höchste Kriterium sind hierbei die C2C-Ziele, die von einer perfekten Umsetzung des C2C Designkonzeptes ausgehen. Also ein Material, das alle Voraussetzungen perfekt erfüllt. Die zweite Kategorie sind die sogenannten Mindestkriterien, also Anforderungen, die mindestens erreicht werden müssen, um von C2C sprechen zu können. Abschließend gibt es die C2C-No-Go Kriterien unter die Maßnahmen oder Inhaltsstoffe fallen, die im Widerspruch zu C2C stehen. Anhand dieser Kriterien kann eingeschätzt werden, wie gut ein Prozess oder Material bereits ist und wo Entwicklungspotenziale bestehen.
Auch wenn die Präsentation noch viele weitere spannende Details und Kapitel beleuchtete, ist es das Beste, die Handreichung selbst zu lesen – und darüber zu sprechen. So taten es im Anschluss an die Vorstellung auch die Teilnehmenden. In einem offenen Frage-Antwort-Format stellten sich Lena Junker, Nora Sophie Griefahn und die zugeschaltete Referentin für Kommunale Entwicklung, Lorena Zangl, den Fragen des Plenums. „Wie kann ich einen Stadtrat von C2C überzeugen?“, „Wie sehen die ersten konkreten Schritte aus?“ und „Kann C2C in das Tagesgeschäft von Verwaltungen integriert werden?“.
Die vielen interessanten Fragen und Anmerkungen hinterließen vor allem einen Eindruck: Das Interesse der Teilnehmenden wurde geweckt und viele neue Denkanstöße geschaffen. Die Handreichung ist ein wirkungsvolles Instrument, das Privatpersonen, Unternehmen und Kommunen an der Hand nimmt und einen Weg aufzeigt, wie Bauen nach Cradle to Cradle im großen, wie kleinen Maßstab erfolgreich umgesetzt werden kann. Ein kleiner Meilenstein für das zirkuläre Bauen.