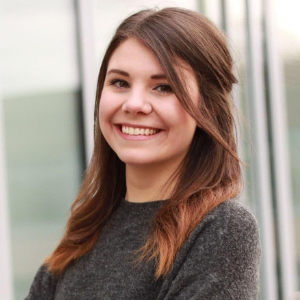In Europa benutzen wir durchschnittlich sieben verschiedene Kosmetika pro Tag. Pro Jahr sind das mehr als fünf Kilogramm pro Person. Hygieneprodukte wie Zahnpasta, Shampoo und Deodorant, aber auch Schönheitsprodukte wie Parfüm, Lippenstift und Make-up. Ein solches Produkt besteht oft aus tausenden unterschiedlichen Substanzen. Wir haben uns angeschaut, warum viele dieser Produkte nicht gesund sind, warum ihre Verpackungen schädlich für die Umwelt sind – und wie ein Kosmetikprodukt nach Cradle to Cradle hergestellt wird.
Immer mehr Konsument*innen machen sich beim Kauf von Kosmetika darüber Gedanken, was eigentlich genau in den Produkten enthalten ist. Der Griff zu sogenannten Naturkosmetika liegt da nahe, denn sie wecken die Hoffnung, dass in ihnen weniger oder gar keine bedenklichen Stoffe enthalten sind. Kein Wunder, dass immer mehr solcher als natürlich bezeichneten Produkte auf den Markt gebracht werden. Doch entgegen vieler Marketingversprechen stehen auch auf Naturkosmetika oft chemische Begriffe, die Konsument*innen, die keine Expert*innen in dem Gebiet sind, völlig unbekannt sind.
Seit Jahren gibt es immer wieder Diskussionen über spezifische Stoffe, die häufig in kosmetischen Produkten vorkommen, darunter Erdöl, Mikroplastik, Parabene oder Aluminium. Mit ihrer Verwendung wird eine Vielzahl an Erkrankungen in Verbindung gebracht: Reizungen der Haut und allergische Reaktionen, aber auch der Verdacht, krebserregend zu sein. Auch alltägliche Beschwerden wie Müdigkeit und Kopfschmerzen können durch diese Stoffe ausgelöst werden.
Der BUND untersuchte 2013 für eine der ersten großen Studie zum Thema rund 60.000 Kosmetikprodukte – und fand in 30 % kritische Chemikalien. Im gleichen Jahr führte die EU neue Richtlinien ein, die einige Inhaltsstoffe deckeln oder ganz verbieten. Dennoch machen sich Konsument*innen Gedanken darüber, ob Stoffe wie Methylparaben, Ethylhexyl, Eugenol und Isoparaffin schädlich sind oder nicht. Sind diese Sorgen begründet? Sorgt die EU mit ihren Standards und Richtlinien dafür, dass nur ungefährliche Inhaltsstoffe mit Körper und Umwelt in Kontakt kommen? Und wenn nicht, sind zertifizierte Naturkosmetika die Lösung? Woraus muss ein Kosmetikprodukt bestehen, um unbedenklich für unsere Haut und die Umwelt zu sein? Diesen Fragen widmen wir uns hier.
Konventionelle Kosmetik- und Pflegeprodukte
Kosmetika bestehen oft aus verschiedenen Stoffen, sogenannte Stoffgemische, die durch die Haut oder den Mund in den Körper und durch den Abfluss in die Umwelt gelangen. Je nachdem, welche Eigenschaften die Produkte erfüllen sollen, werden biologische und chemische Stoffe vermischt. Dabei enthalten fast alle Produkte Konservierungsmittel, denn diese verhindern die Zersetzung des Endprodukts durch Mikroorganismen und machen es so haltbar. Konservierungsmittel sind oft synthetische Stoffe und viele davon sind hormonell wirksam. Öffentliche Diskussionen über Konservierungsmittel wie Parabene und Formaldehyd, etwa in Shampoo, führten zu einer geringeren Akzeptanz dieser Stoffe bei Verbraucher*innen. Das Problem mit Parabenen und Co.: Sie wirken im Körper ähnlich wie Hormone. Häufig ähneln sie dem weiblichen Geschlechtshormon Östrogen und beeinflussen so insbesondere Frauen, Kinder, Schwangere, Föten und Jugendliche in der Pubertät.
In der EU gibt es gesetzliche Regelungen, die manche Konservierungsmittel verbieten und für andere einen Grenzwert vorgeben. Trotzdem bleiben sie problematisch. Denn erstens gibt es medizinische Berichte darüber, dass auch kleinste Mengen Konservierungsstoffe Beschwerden wie Juckreiz, Rötungen und Allergien auslösen können. Auch Unfruchtbarkeit, verfrühte Pubertät sowie Brust-, Hoden- und Prostatakrebs wurden schon mit Konservierungsstoffen in Verbindung gebracht. Und zweitens regeln die EU-Gesetze nur Konservierungsmittel, die bereits als gefährlich eingestuft sind. Dabei werden Jahr für Jahr neue Stoffe mit unbekannten Folgen genutzt. Viele Kosmetiklinien werben damit, dass ihre Produkte „frei von…“ einem bestimmten schädlichen Stoff sind. Damit ist aber nicht ausgeschlossen, dass das Substitut nicht ebenso schädlich ist. Möglicherweise handelt es sich nur um einen neuen Stoff, dessen Schädlichkeit noch nicht nachgewiesen ist. Komplett frei von konservierenden Zusätzen sind häufig nur wasserfreie, trockene Substanzen, wie Puder. Denn die Trockenheit bietet Mikroorganismen keinen Nährboden, sich zu vermehren. Da kosmetische Konservierungsstoffe nicht zwischen Keimen unterscheiden können, greifen auch kleinsten Mengen in Gewässern die dort natürlich lebenden Mikroorganismen an und schaden so unserer Umwelt. Aus diesem Grund ist bei Cradle to Cradle elementar, dass sämtliche in einem Produkt verarbeiteten Stoffe positiv definiert sind. Wir setzen uns dafür ein, dass wir genau definieren, welche Stoffe in einem Shampoo oder in Mascara enthalten sein dürfen, anstatt einige schädliche Mittel auszuschließen, andere aber nicht.
Duftstoffe und Mikroplastik
Wie wichtig eine solche positive Definition von gesunden und geeigneten Stoffen ist, wird auch bei der Betrachtung von Duftstoffen deutlich. Duftstoffe sind einer der am häufigsten verwendeten Inhaltsstoffe ohne echte Wirkung. Weil wir alle gerne Produkte kaufen, die gut riechen – und uns gut riechen lassen – enthalten fast alle Duschgels, Deos und Cremes Duftstoffe. Sie sind auf der Verpackung meist nur als „Parfum“ oder „Fragrance“ gekennzeichnet. Nur 26 besonders allergieauslösende Duftstoffe müssen ab einer bestimmten Menge in der Inhaltsstoffliste genannt werden. Obwohl sie als bedenklich eingestuft sind und teilweise als krebserregend gelten, sind sie nicht verboten. Auch Naturkosmetik verzichtet oft nicht auf Duftstoffe. Allerdings kann man darauf achten, explizit duftstofffreie „Sensitiv“-Naturkosmetik zu kaufen.
In den vergangenen Jahren wurde in Bezug auf Kosmetikprodukte vor allem über darin enthaltenes Mikroplastik diskutiert. Auch deshalb verkaufen viele Herstellfirmen inzwischen Produkte, die explizit als Mikroplastik-frei gekennzeichnet sind. Bei Mikroplastik handelt es sich um winzige Kunststoffpartikel, die zum Beispiel als kleine Kügelchen im Peeling genutzt werden. Der BUND warnt aber vor deutlich mehr Kunststoffen als nur feste Plastikartikel. Unter dem Begriff Mikroplastik fassen Wissenschaftler*innen nämlich auch Kunststoffe die wasserlöslich sind oder in flüssiger, gel- oder wachsförmiger Struktur in Produkten auftauchen. Laut einer NABU-Studie werden jährlich durch die Nutzung von Plastikpartikeln in Kosmetik- und Reinigungsprodukten ca. 1.000 Tonnen Mikroplastik und gelöste Polymere in das Abwassersystem geleitet. Mikroplastik, in flüssiger oder fester Form, ist problematisch für uns und die Umwelt. Denn Kläranlagen können es nicht aus dem Wasser filtern und so gelangt es in Flüsse und Meere. Dort wird es von Fischen und Algen aufgenommen und gelangt so in die menschliche Nahrungskette. Ende 2020 entdeckten italienische Forscher*innen erstmals Mikroplastik in der menschlichen Plazenta – unter anderem von Polypropylen, wie es in Plastikverschlüssen verwendet wird. Was Mikroplastik genau im menschlichen Körper auslöst, ist noch vollkommen unerforscht.
Fossile Brennstoffe, Schweiß und Palmöl
Von Aluminium ist vor allem in Deodorants die Rede. Während aluminiumfreies Deo in erster Linie den Schweißgeruch überdeckt, verhindern oder reduzieren Antitranspirantien, in denen Aluminium enthalten ist, das Schwitzen ganz. Die Aluminiumsalze verschließen die Poren und hemmen so den Schweißfluss. Durch einen permanenten Stopp kann Schweißstau entstehen, der Hautreizungen und Juckreiz auslöst. Durch gereizte Haut, zum Beispiel nach der Rasur, kann das Aluminium zudem in den Körper gelangen. Zwar wird über die Gefahr von Aluminiumsalzen vor allem im Zusammenhang mit Deos diskutiert – dem Bundesinstitut für Risikobewertung zufolge nehmen wir jedoch deutlich mehr davon über Nahrungsmittel und Kosmetika wie Lippenpflegestifte oder aufhellende Zahncreme auf, als über Deos. Wird der Aluminiumgehalt im Körper zu hoch, könne das nach derzeitigem Kenntnisstand negative Auswirkungen auf das Nervensystem, die Nieren und die Knochen haben.
In fast allen Kosmetik- und Pflegeprodukten ist in irgendeiner Form Erdöl enthalten. Denn viele Inhaltsstoffe werden auf Basis von Erdöl hergestellt. Ob als fettende Komponente in Cremes oder Make-Up oder als „Wax“ in Shampoos oder Zahnpasta. Erdöl bildet auch den Ausgangsstoff für andere Inhaltsstoffe wie UV-Filter oder Duftstoffe. Die riskante Förderung und Verwertung von Erdöl als fossilem Brennstoff sind problematisch für die Umwelt. Und für uns Menschen ist Erdöl hautschädigend. Denn der Inhaltsstoff dichtet die Haut ab – sie wirkt dann glatt und weich, kann aber nicht richtig atmen und trocknet aus. Ebenso schädlich für die Umwelt ist der massenhafte Einsatz von Palmöl. Die Turbo-Anbaumethoden aufgrund der häufigen Verwendung in Kosmetik oder Lebensmitteln führen schon heute in Südostasien und Südamerika zu gewaltigen Umweltzerstörungen, unter anderem durch die Vernichtung von Regenwald.
EU-Richtlinien
Europa hat weltweit die umfangreichsten Gesetze über Kosmetika. Darin sind Stoffe aufgeführt, die verwendet werden dürfen, die gewissen Beschränkungen unterliegen und die verboten sind. Die so genannte Kosmetikverordnung regelt die Menge der Stoffe, deren Zulassung und Anwendungsform und die Pflicht zur Kennzeichnung auf den Verpackungen. Sie wird regelmäßig angepasst und erweitert. Doch trotz der EU-Kosmetikverordnung warnen viele Organisationen und Wissenschaftler*innen weiterhin vor gefährlichen Inhaltsstoffen in Kosmetika. Apps wie der ToxFox des BUND sollen Konsument*innen dabei unterstützen, gesunde Produkte einzukaufen. Die Apps scannen Produkte beim Einkauf und prüfen sie auf ihre Unbedenklichkeit hin. Doch auch diese Apps machen nur auf Stoffe aufmerksam, die auf behördlichen Listen als schädlich verzeichnet sind. Wer als Verbraucher*in wirklich sicher sein will, muss zu Pflege- und Kosmetikprodukten greifen, die ausschließlich biologische Inhaltsstoffe verwenden und durch ihre Kreislauffähigkeit unsere Umwelt und Ressourcen schonen.
Cradelige Kosmetik
Kosmetik- und Pflegeprodukte gelangen durch die Haut in unseren Körper und durch den Abfluss in Gewässer und Umwelt. Sie sind also Verbrauchsprodukte und müssen deshalb biologisch abbaubar sein. Da chemische Substanzen in normalen Kläranlagen nicht von biologischen getrennt werden, sollte also etwa ein Shampoo, abgesehen von der Verpackung, ausschließlich aus biologischen Materialien bestehen. Shampoo hergestellt nach Cradle to Cradle-Kriterien verwendet weniger, dafür aber nur gesunde Materialien. Die verwendeten Materialien schonen unsere endlichen Rohstoffe durch die Vermeidung von endlichen Ressourcen und schützen unsere Umwelt. Die Materialien kommen aus der Nähe des Herstellungsorts oder sind Abfallprodukte einer nahegelegenen Produktion. Die Verpackungen sollten nach der Nutzungszeit im Handel, bei Herstellfirmen oder in der Rohstoffsammlung abgegeben werden können. Dort werden die Materialien sortenrein voneinander getrennt und so ohne Qualitätsverlust recycelt. Da alle Materialien und Bestandteile des kosmetischen Produkts entweder biologisch abbaubar oder wiederverwendbar sind, entsteht kein Müll. So wird sichergestellt, dass nur gesunde Stoffe und Materialien in unserem Körper und in der Umwelt landen. Für diese Art und Weise der Produktion von Kosmetika gibt es bereits Beispiele, die im üblichen Handel erhältlich sind.
Pioniere
Die Naturkosmetikmarke Aveda nutzt ausschließlich natürlich gewonnene Inhaltsstoffe, produziert mit 100 % Windenergie, hat ihre Unternehmensstrategie nach Cradle to Cradle-Kriterien ausgerichtet und verwendet 100 % recyceltes PET. Unter anderem stellt Aveda Shampoo und Conditioner nach C2C-Kriterien her. Von Kiehl’s sind Haut- und Haarpflegeprodukte, von Redken Haarprodukte, von ADA Cosmetics Make-up und Hautpflege, von Bravo Sierra Hautpflegeprodukte und von Lanz Natur eine ganze Serie an Naturkosmetik nach Cradle to Cradle-Kriterien erhältlich.
Diese Marken sind auf Zulieferfirmen angewiesen, die natürliche Produkte aus biologisch angebauten Zutaten herstellen. Mit Peel Pioneers entsteht in den Niederlanden gerade die größte Bioraffinerie zur Verarbeitung von Orangenschalen in Europa. Supermärkte, Restaurants und Hotels können dort ihre Orangenschalen entsorgen. Daraus wird Orangenöl hergestellt, das in Kosmetika und Waschmitteln, aber auch in Bier, Limonaden und Schokolade verwendet wird. So wird der biologische Kreislauf geschlossen. Auch Bionorica orientiert sich in ihrer Unternehmensstrategie an Cradle to Cradle-Kriterien und produziert ausschließlich pflanzliche Arzneimittel. So werden pflanzliche Abfallprodukte, wie zum Beispiel Mandelschalen, aus der Herstellung in einer Biogasanlage zur Stromerzeugung genutzt.
Wie in einer Vielzahl anderer Industriebereiche gibt es auch in der Kosmetikindustrie schon gute Beispiele für zukunftsorientiertere Produktionsweisen und Produkte. Trotzdem bleiben viele Herausforderungen bestehen. Konsument*innen müssen aufgeklärt werden und die Politik muss Rahmenbedingungen schaffen, in denen die positive Definition von Materialien und Inhaltsstoffen möglich ist. Der Ansatz „frei von“ schließt die Verwendung von giftigen Stoffen, die Mensch und Umwelt nicht schaden, nicht aus. Und das muss unser Ziel sein, ganz besonders, wenn es um Kosmetikprodukte geht, die wir täglich mit unserer Haut in Berührung bringen.