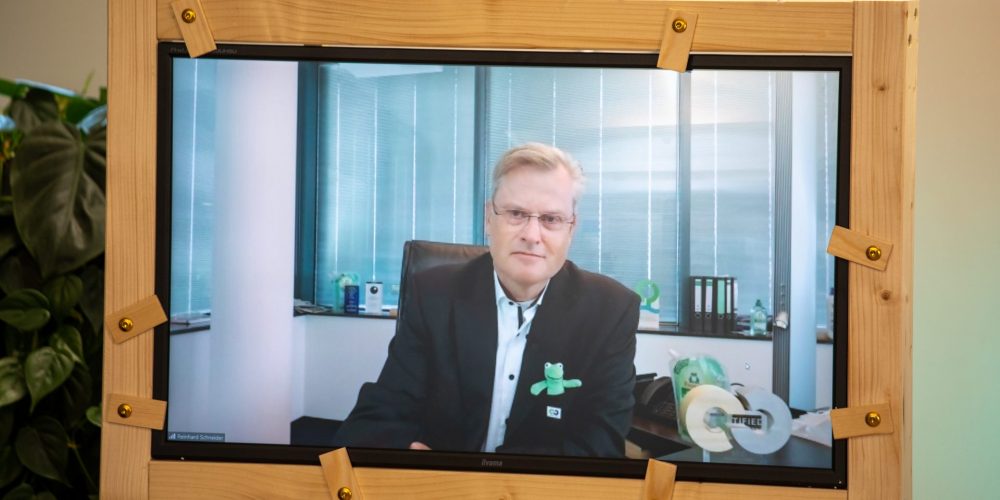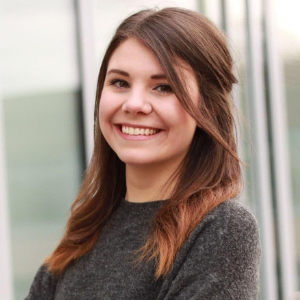Im Gespräch mit C2C NGO sprach Reinhard Schneider über Cradle to Cradle als Ansatz, um Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft konkret umzusetzen und welche politischen Rahmenbedingungen es braucht, um C2C zu skalieren. Das Interview könnt Ihr Euch auf YouTube anschauen oder hier als Transkript lesen.
Können Sie kurz beschreiben, warum der C2C Congress und seine Inhalte wichtig sind?
Wir sehen ja, dass gerade in der heutigen Zeit – in der alle über Nachhaltigkeit reden – eine Konkretisierung nottut. Das heißt, man muss auch aufzeigen, mit welchen Methoden man Nachhaltigkeit umsetzt. Das ist natürlich erstmal die Kreislaufwirtschaft, die schon mehr oder weniger ein ausgetretenes Wort ist. Aber welche Optionen innerhalb der Kreislaufwirtschaft unter welchen Bedingungen funktionieren, und wie sie genau zu messen sind, da ist Cradle to Cradle wirklich der beste, detaillierteste und wissenschaftlichste Ansatz. Und er schafft natürlich auch Hoffnung, dass etwas machbar ist. Er zeigt auch auf, in welche Richtung man sich bemühen muss. C2C ist damit auch eine Sensibilisierung für diejenigen, die fragen: Wie machen wir das denn jetzt?
Was war die Motivation von Werner & Metz, Cradle to Cradle einzuführen?
Wir wollten bei den vielen Ansätzen die Möglichkeit haben, ein bisschen die Spreu vom Weizen zu trennen. Wir haben uns überlegt, nach welchen Kriterien man diese Messbarkeit so einrichtet, dass wir die relevanten Dinge auch wirklich erfassen können. Es hat eine Weile gedauert, zu schauen was es denn für Systeme gibt. Cradle to Cradle war uns relativ früh aufgefallen. Es ist natürlich auch für uns eine willkommene Herausforderung gewesen, bei einem so anspruchsvollen Tool – was ja bis runter auf wenige Parts per Million die Inhalte analysiert – dann sehr überdurchschnittliche Werte erzielen zu wollen und damit in die Kommunikation zu gehen.
Wie reagieren ihre Kund*innen auf ihre Cradle to Cradle-Produkte?
Wir unterscheiden in ein Zwiebelschalen-Modell der Kommunikation: An der oberflächlichsten Zwiebelschale hat man natürlich sehr anspruchsvolle Kommunikationsbedingungen. Das will heißen, die Zeit, die eine durchschnittliche Hausfrau oder ein durchschnittlicher Hausmann, sich zur Entscheidung vor dem Supermarktregal nimmt, beträgt gerade mal zweieinhalb Sekunden. In den zweieinhalb Sekunden kann man keine wissenschaftliche Dissertation über Energie-Bilanzen, Stoffströme, Toxizität und Risikofaktoren transportieren – das ist klar. Da geht es um Vertrauenswürdigkeit. Aber Vertrauenswürdigkeit wird letztlich auch sehr stark über die ganzen Stakeholder gebildet, die dann in den weiter tiefer liegenden Zwiebelschalen schon mal auf der Homepage recherchieren, oder bei den NGOs schauen, was die über den Hintergrund der Firma schreiben: Meinen die es wirklich ernst oder tun die nur so? Die Influencer, was sagen die? Jeder kennt jemanden, der auch schon mal genauer nachgeguckt hat. Und dann wird es eben interessant. Dann macht es auch Sinn, in der Tiefe – der wissenschaftlichen Tiefe der Zwiebel – auch belegen zu können, warum wir uns mit unseren Technologien in der Kreislaufführung überlegen fühlen. Auch für Kundenkreise, bei denen die Leute sich etwas mehr Zeit nehmen für die Entscheidung. Das ist zum Beispiel im professionellen Bereich, im B2B, so. Das heißt, dieses sogenannte ‚Green Public Procurement‘ steckt ja leider auch noch in den Kinderschuhen. Es wird zwar abstrakt immer gefordert und auch angekündigt, aber umgesetzt wird es selten. Und wenn, dann auch mit gewissen Unsicherheiten: Wie messen wir denn, ob das wirklich grün und Kreislauffunktionierend ist? Und ich denke, da kann Cradle to Cradle einen sehr wertvollen Baustein liefern, um Belege und Vergleichbarkeiten herzustellen.
Sehen Sie in der breiten Industrie ein steigendes Bewusstsein dafür, wie wichtig es ist, Produkte bereits für geschlossene Ressourcenkreisläufe zu entwerfen?
Nach unserer Erfahrung ist diese Sensibilität sehr hoch, aber viele wissen nicht an welchen Merkmalen das festgemacht werden kann. Das heißt, es gibt leider auch noch große Irreführungsbeispiele, wo man eine vermeintliche Kreislauflösung – weil sie so intuitiv erscheint – in den Vordergrund rückt, obwohl die Wissenschaft eigentlich was ganz anderes sagt. Es gibt also irgendwelche Nachfüll-Stationen für Putzmittel, bei denen nachweislich für die Kanister, die dareingesetzt werden, deutlich mehr Single-Use-Plastic verwendet wird, als zum Beispiel bei Nachfüllbeuteln, wie wir sie verwenden – gemessen an der verkauften Liter-Zahl pro Liter-Wirkstoff. Und dann versucht man zu suggerieren: Das ist die perfekte Kreislaufführung, wenn man Nachfüllstationen hat. Aber allein über die Kanister schickt man mehr Plastik irgendwo in die Verbrennung oder, wenn man Glück hat, ins Recycling, als wenn man Nachfüllbeutel nehmen würde und das Zuhause macht. Es gibt also noch viel Irreführung. Deswegen ist es gut zu vergleichen, zu rechnen und zu schauen, wie viel Plastik eingespart werden kann, ohne dass man unzumutbar in der Art der Anwendung und Darreichung wird. Das Ganze soll auch mehrheitsfähig bleiben – denn wenn das alles in der Nische immer kleiner wird, wird dem Planeten auch nicht geholfen. Das wenige Plastik, was dann unvermeidlich ist: Wie kann das auch am energieschonensten in einem mengenmäßig komplett geschlossenen und auch qualitativ komplett geschlossenen Kreislauf gehalten werden? Diese drei Kriterien sind für uns eigentlich die heilige Troika. Also komplett geschlossen in der Menge, komplett geschlossen in der Qualität, und was viele halt übersehen, mit einem Minimum an Energie. Das schließt zum Beispiel das chemische Recycling aus.
Was braucht es, um Cradle to Cradle global zu skalieren?
Das eine ist die Sensibilisierung der Verbraucher. Das versuchen wir ja auch schon seit längerem und auch nicht ohne Erfolge. Auf der anderen Seite muss man natürlich sehen, gerade in Warengruppen die sehr preisaggressiv sind, also z. B. Waschmittel oder Spülmittel, werden viele einfach nur gekauft, wenn sie gerade in der Preis-Aktion sind. Da muss man natürlich schauen, dass der unökologischste Umgang mit dem Material Plastik nicht der billigste bleibt. Dann sind wir wieder bei dem Thema der politischen Rahmenbedingungen: Dass der unökologischste Umgang der ist, der von der Bundesregierung am meisten subventioniert wird, will nicht so ganz in meinen Kopf rein. Die europäische Vorgabe der Plastik-Steuer auf Virgin Plastic wird einfach nicht an die Verursacher in Deutschland durchgereicht, sondern soll vom anonymen Steuerzahler einfach weggezahlt werden. Stattdessen sollte das Material teurer werden, was am unökologischsten ist, um eine Lenkungswirkung hinzukriegen. Also da braucht es auch den Mut der Regierungen die Rahmenbedingungen so zu setzen, dass man diese – auf Englisch sagt man das schöne „one level playing field“ – fairen Wettbewerbs-Grundvoraussetzungen hat, in denen nicht das eine Material eine Förderung kriegt und das andere nicht. Und wenn eines eine Förderung überhaupt verdienen würde, dann bitte das, was den ökologischsten Weg darstellt, und nicht umgekehrt. Eigentlich ein No-Brainer, wie es so schön heißt. Aber da stecken natürlich sehr mächtige Lobbyinteressen hinter dem gegenteiligen, immer noch andauernden, Verhalten.

Reinhard Schneider ist geschäftsführender Gesellschafter und Alleineigentümer des Reinigungsmittelherstellers Werner & Mertz. Nach seinem Studium der Betriebswirtschaft mit dem Schwerpunkt Absatz und Handel an der Universität St. Gallen war Schneider zunächst sechs Jahre lang im Marketing tätig, unter anderem als Produktmanager bei Nestlé/Schweiz. 2000 übernahm er den Vorsitz der Geschäftsführung von Werner & Mertz und ein Jahr später die Leitung der Consumer-Sparte im Unternehmen. Schneider ist ein Nachfahre der Gründer des Familienunternehmens. 2019 erhielt er den Deutschen Umweltpreis für seine ganzheitlich nachhaltige Firmenausrichtung.