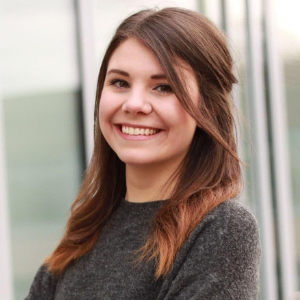Text: Anna-Karina Reibold
Smartphones, Fernseher, Waschmaschinen oder Lautsprecher – elektronische Geräte sind allgegenwärtig. Doch die Innovationen von heute sind gleichzeitig der Elektroschrott von morgen. Noch immer sind Geräte kaum reparierbar, Materialien schwer wiederverwendbar und ihre Gewinnung erfolgt unter prekären Bedingungen. Besonders paradox ist, dass ausgerechnet eine Branche, deren Innovationskraft von endlichen Rohstoffen abhängt, weiterhin nach linearen Geschäftsmodellen wirtschaftet. In den vergangenen Monaten haben wir uns dafür starkgemacht, echte Kreislauffähigkeit in der Consumer Electronics Branche voranzubringen – genau dort, wo sie bislang noch kaum eine Rolle spielt.
Bislang folgt die Herstellung von Elektrogeräten einem linearen Prinzip: produzieren, nutzen, wegwerfen. Das fordert enorme Mengen wertvoller Rohstoffe. Allein in den 27 EU-Staaten fielen 2022 rund fünf Millionen Tonnen Elektroschrott an, davon etwa 900.000 Tonnen in Deutschland. Dabei sind Smartphones, Kühlschränke und Fernseher wahre Schatzkammern an Rohstoffen. Eine Tonne Handyschrott enthält im Schnitt rund 2,5 Kilogramm Silber, 92 Kilogramm Kupfer sowie Palladium, Gold und Kobalt. Doch nur rund zehn Prozent der Smartphones werden tatsächlich recycelt. Auch bei Altbatterien liegt die Quote mit etwa 50 Prozent niedrig. Doch selbst die wenigen Geräte, die tatsächlich recycelt werden, gelangen meist nicht in einen echten Kreislauf. Ein Produkt, das nach ein oder zwei Recyclingprozessen schließlich doch zu Elektroschrott wird, ist keine zukunftsfähige Lösung.
Mit dem Ziel, C2C in der Consumer-Electronics-Branche zu verankern, sind wir dieses Jahr eine Partnerschaft mit der IFA Berlin eingegangen. Im Juli luden wir zu einem Roundtable ein, der Akteur*innen aus verschiedenen Segmenten der Branche zusammenbrachte. Teilnehmende waren unter anderem Vertreter*innen von EPEA – Part of Drees & Sommer, Cradle to Cradle Products Innovation Institute, Canon Deutschland, LIEBHERR Hausgeräte, ZUMTOBEL Group, Tridonic GmbH & Co KG, Siemens AG, MediaMarkt Saturn Retail Group und WIK Group.
Ziel des Roundtables war es, Erfahrungen auszutauschen, Impulse zu setzen und voneinander zu lernen. „Gerade weil es so dringend ist, ist es großartig, ins Gespräch zu kommen – sowohl mit den Unternehmen, die schon viel umsetzen, als auch mit denen, die noch am Anfang stehen“, betonte Nora Sophie Griefahn, geschäftsführende Vorständin von Cradle to Cradle NGO.
Im Zentrum der Diskussion stand das Design als Hebel für Kreislauffähigkeit. Denn Nachhaltigkeit beginnt beim Design. Dabei wurde auch betont, dass der Blick über CO₂-Emissionen hinausgehen muss und nicht in einer reinen Carbon-Tunnel-Perspektive verharren sollte. Auch soziale Auswirkungen sowie die globalen Folgen von Rohstoffabbau müssen in den Blick genommen werden, um eine wirklich zukunftsfähige Wirtschaft zu gestalten.
Cradle to Cradle verfolgt genau diesen ganzheitlichen Ansatz. Bereits in der Designphase wird geprüft, welche Materialien verwendet werden, wie sie trennbar bleiben und in technische oder biologische Kreisläufe zurückgeführt werden können. Grundvoraussetzung sind dabei faire Arbeitsbedingungen, erneuerbare Energien, sauberes Wasser, saubere Luft sowie ein konsequentes Kohlenstoff- und Treibhausgasmanagement.
Best Practices
So viele Herausforderungen es derzeit gibt – es zeigen sich bereits vielversprechende Ansätze. Cradle to Cradle wird bereits praktisch gelebt, auch in der Consumer Electronics Branche. Während des Roundtables kamen mehrere Unternehmen zu Wort. Die gesammelten Erfahrungswerte flossen anschließend gebündelt in das Positionspapier von Cradle to Cradle NGO ein.
Kühlen mit Vulkangestein
LIEBHERR präsentierte seinen ersten modularen C2C-Gefrierschrank. Möglich macht es die BluRox-Technologie: Statt PU-Schaum dient feingemahlenes Vulkangestein in Vakuumverpackung – ein nahezu unbegrenzt verfügbarer Rohstoff – als Isolierung. Die Kühlleistung bleibt über Jahre konstant, das Innenvolumen wächst um bis zu 30 Prozent.
Zirkuläre Druckerlösungen
Der ganzheitliche C2C-Ansatz und seine Bedeutung spiegelten sich in den erfolgreichen Geschäftsmodellen der teilnehmenden Unternehmen wider. Canon Deutschland berichtete, dass der Standort Gießen auf diesen Ansatz setzt, um den positiven Impact über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg zu maximieren. Es entstand ein standardisierter Remanufacturing-Prozess: Geräte werden zerlegt, gereinigt, geprüft, wieder zusammengesetzt und mit neuer Software auf den Markt gebracht. Dies geschieht ohne Qualitätsverlust, mit neuer Seriennummer, zurückgesetztem Zähler und vollem Garantieanspruch. Bereits rund 90 % der Materialien können auf diese Weise wiederverwendet werden. Mit jeder neuen Produktgeneration steigt der Anteil recycelter Materialien und die Geräte werden gleichzeitig energieeffizienter.
Lichtlösungen zirkulär gedacht
Materialinnovationen wie PFAS-freie Lacke oder halogenfreie Komponenten standen ebenfalls auf der Agenda. Die Zumtobel Group berichtete, dass sie seit einiger Zeit zirkuläre Prinzipien in ihre Produktentwicklung integriert. Im Mittelpunkt steht die Frage, wie sich Leuchten am Ende ihres Lebenszyklus demontieren, reparieren oder wiederaufbereiten lassen. Verklebte Komponenten werden durch verschraubte ersetzt, Materialgesundheit und Recyclingfähigkeit werden bereits in der Entwicklung berücksichtigt. Werkzeuge wie der digitale Produktpass sollen künftig Informationen über Energieverbrauch und Gerätezustand der Geräte bereitstellen.
Diese Erfahrungswerte flossen in das Positionspapier „Consumer Electronics & Cradle to Cradle“ ein. Darin finden sich zahlreiche weitere Best Practices sowie ein Überblick, wie Geräte nach Cradle to Cradle gestaltet werden können.
Herausforderungen und Rahmenbedingungen
Beim Roundtable kamen auch die praktischen Hürden und regulatorischen Vorgaben zur Sprache. Öffentliche Beschaffungsrichtlinien bevorzugen häufig Neugeräte, was den Einsatz von remanufactured Produkten erschwert. Positive Beispiele gibt es jedoch: In Ludwigsburg trat 2018 eine bindende Dienstanweisung zur nachhaltigen Beschaffung in Kraft, die sich an C2C orientiert.
Zudem bleiben Supply-Chain-Themen weiterhin kritisch. Verlässliche Daten sind nötig, um zirkuläre Geschäftsmodelle umzusetzen, doch mangelnde Transparenz und fehlende soziale sowie ökologische Standards erschweren eine echte Kreislauffähigkeit. Digitale Produktpässe, die Informationen zu Nutzung, Materialien, Stromverbrauch und Gerätezustand liefern, könnten hier Abhilfe schaffen. Gleichzeitig sind neue Nutzungsmodelle bei Kund*innen noch wenig verbreitet, und Rücklaufquoten sind gering. Pfandsysteme wurden als mögliche Lösung erwähnt. Auch die Qualitätssicherung beim Refurbishment erfordert angepasste Produktionsstätten.
Um diesen Herausforderungen zu begegnen, wurden zirkuläre Geschäftsmodelle vorgestellt. Konzepte wie „Nutzen statt Besitzen“ sorgen dafür, dass Produkte und ihre hochwertigen Materialien beim Hersteller bleiben. Rücknahmesysteme, Demontageprozesse, Materialpooling und passende Logistik bilden das Rückgrat dieser Modelle.
Impulse für die Branche
Unsere Arbeit am Thema Consumer Electronics zeigt: Es verändert sich was. Der Wandel ist ein kontinuierlicher Prozess ist. Oft beginnt das Umdenken mit der Optimierung einzelner Produkte oder eines einzelnen Kriteriums wie der Materialgesundheit. Anpassungen in Produktionsprozessen, gezielte Investitionen und ein ganzheitlicher Ansatz machen C2C zu einer Strategie, die Wettbewerbsfähigkeit und Zukunftsfähigkeit sichert. Denn der Umstieg lohnt sich! Laufende Kosten sinken, die betriebliche Resilienz steigt, die Markenwahrnehmung verbessert sich, und frühzeitige Anpassungen an regulatorische Vorgaben und Umweltstandards werden möglich. Angesichts der steigenden Rohstoffknappheit wird so auch die Produktionsgrundlage von morgen gesichert.
Wir müssen jetzt den nächsten großen Schritt gehen – einen über die Reduktion von Treibhausgasen und Energieeffizienz hinaus. Veränderung ist möglich, wenn die gesamte Wertschöpfungskette betrachtet, Design als Hebel genutzt und ökologische, ökonomische sowie soziale Aspekte zusammengedacht werden. Nur so entstehen Elektronikgeräte mit positivem Fußabdruck.
Mehr zu unserer Arbeit zu Consumer Electronics: